|
___KLEINE PFADE
– VERSCHRÄNKTE GESCHICHTEN
Eine 3-tägige Filmreihe mit
Kommentaren
19.-21.09.2009 im Haus der Kulturen der Welt
Diese Filmreihe (Programm- und Filmbeschreibungen
siehe >> kleinepfade.pdf)
setzt sich auf die Spur verschlungener, abgelenkter und sich
verlierender Wege, welche die großen Machtlinien im
(post)kolonialen urbanen Raum zwischen Nordafrika und Europa
durchqueren und im Kino reflektiert werden.
Einen Blick auf solche Seitenpfade wagen
1968 Magid Rechiche, Mohammed Tazi und Ahmed Bouanani mit
dem Film 6 ET 12. Der Film hält Ausschau nach den ausfasernden
Rändern der geregelten Ordnung in der modernen Metropole
Casablanca. Dabei zeigt er aber keineswegs das Elend der Bidonvilles,
von denen Filmbilder zu machen ohnehin nicht erlaubt war,
sondern spürt den leichten Brüchen in der Schwere
einer routinierten Normalität nach, im Gleichtakt eines
glorifizierten Fortschritts. Von diesem handelt auch AUBERVILLIERS
von Eli Lotar, der als Kameramann mit Luis Bunuel zusammengearbeitet
hatte, gedreht im Sommer 1945. Der Film führt uns in
die Industrie-Vorstadt: Die Müllverbrennungsanlage von
Paris, improvisierte Behausungen und die Arbeit mit der Natronlauge.
Pierre Laval, Autor des „Décret Laval“
von 1934, das Filmaufnahmen im kolonialen, frankophonen Afrika
reglementierte, war fast 20 Jahre lang Bürgermeister
von Aubervilliers, bis er 1944 als Kollaborateur hingerichtet
wurde. Im Film kommt er vor als einer, der „das Blaue
vom Himmel versprach: Moderne Häuser. Einen überdachten
Markt, sonniges und günstiges Wohnen. Fließend
Wasser, eine Musterschule, Spielplätze. Kindergärten.“
Eine Trickmontage im Bilderrahmen zeigt uns die Versprechen
der Moderne.
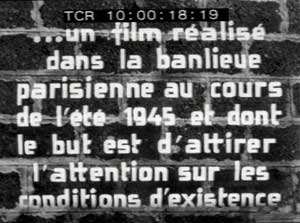
Still: AUBERVILLIERS
Das Kino ist selbst ein Ort der Produktion
und der Verschränkung unterschiedlicher Räume der
Moderne. Dazu gehören nicht nur die Interventionen des
Kolonialismus, sondern auch vielfältige Widerstandsformen,
die sich zum einen in der Alltagskultur, aber auch auf der
politischen Bühne zeigen. So lassen in TRÉSORS
DE SCOPITONES ARABES, KABYLES ET BERBÈRES von 1999
die Regisseurinnen Michèle Collery und Anaïs Prosaïc
die Welt der maghrebinischen Cafés im Paris der 1960er-
und 1970er-Jahre wieder aufleben. Es ist die Welt auch der
Scopitones, der 16-mm-Kurzfilme aus der gleichnamigen Bilder-Jukebox:
nostalgische Lieder und erzählerische Performances, etwa
eines Salah Sadaoui, der sich über die harten Bedingungen
in der Migration mokiert, hippie-eske orientalische Tanzeinlagen
oder der Berber-Glam-Rock einer Gruppe wie Les Abranis. In
einer Bar in Belleville führt der Film Beteiligte der
Erfolgsgeschichte dieses Formats und einige der Stars von
damals wieder zusammen: Die Scopitones sind im Zuge der Verbreitung
von Audiokassetten, Video, Fernsehen und freien Radios verschwunden,
genauso wie die meisten der Cafés.
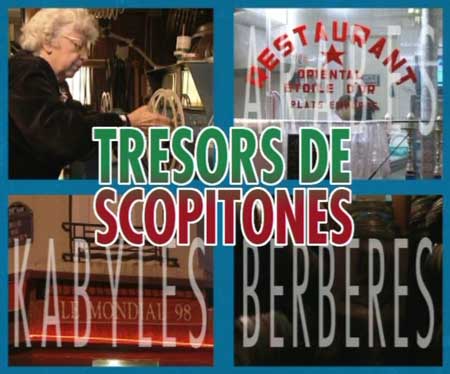

TRÉSORS DE SCOPITONES ARABES, KABYLES ET BERBÈRES
Gezeigt wird in Kleine Pfade auch der erste
französische antikoloniale Film überhaupt: AFRIQUE
50 von René Vautier.
Der Film war 40 Jahre lang verboten, genauso wie Vautiers
Kurzfilm LE GLAS, den er unter seinem Gefangenennamen „Ferid
Dendeni“ 1964 zur Unterstützung der ZAPU (Zimbabwe
African Party for Unity) produzierte. In einem ausführlichen
Publikumsgespräch wird Vautier sein Engagement mit der
„Kamera als Waffe“, das von der bretonischen Résistance
über den algerischen Widerstand und die Streikunterstützung
der Bergleute reicht, an Ausschnitten seiner Filme erläutern.
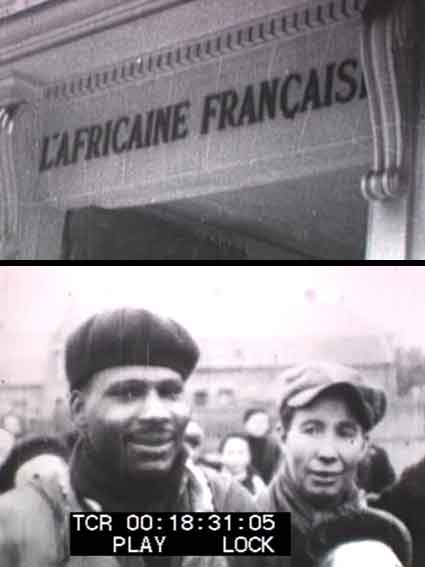
AFRIQUE 50
___Das Centre Cinématographique Marocain (CCM) in Rabat,
Marokko
Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung
des Manifestes der Unabhängigkeit am 11. Januar 1944
wurde am 9. Januar das Centre Cinématographique Marocain
(CCM) unter der Direktion des Franzosen Henri Monjeau, der
zudem als Pressechef der "Résidence générale"
fungierte, gegründet. Die Aufgabe des CCM sollte nicht
nur aus der Distribution und Bewirtschaftung des Filmsektors
bestehen, sondern eine marokkanische Filmproduktion in Gang
bringen, die, wie der Filmwissenschaftler Abdelkader Benali
(Le cinéma colonial au maghreb, Les Editions du Cerf,
1998) es formuliert, den wachsenden Einfluss des ägyptischen
Kinos zurückdrängen und die Verbreitung arabisch-islamischer
Nationalismen unterbinden sollte. Institutionelles Vorbild
war das Centre National du Cinéma (CNC), das unter
dem Vichy-Regime entstanden ist.
Der erste Student am Institut des Hautes Etudes Cinématographiques
(IDHEC) – der Filmschule in Paris – mit maghrebinischem
Hintergrund war Ahmed Belhachmi, der 1958 am CCM nach Henri
Monjeau die Leitung übernahm. Ein sehr grosser Anteil
der Filmproduktion in den ersten zwölf Jahren nach der
Unabhängigkeit Marokkos – vor allem Kurzfilme und
Auftragsfilme – fand im institutionellen Rahmen des
CCM statt, wohingegen die koloniale Infrastruktur von 350
35mm-Kinos privatisiert worden war. Ab 1958 produzierte das
CCM eine eigene Wochenschau. Ausser ein paar wenigen Ausnahmen
führte erst die Umstrukturierung der Institution 1977
dazu, dass RegisseurInnen längere Spielfilme in Koproduktion
mit dem CCM realisieren konnten. Zu Beginn der 1980er Jahre
wurde mit dem "fonds de soutien" im Rahmen des CCM
ein Fördersystem installiert (1987 in den "fonds
de l'aide" umgewandelt). Seit dieser Zeit stellt das
CCM einen kinematographischen Komplex dar, der Archiv, Kino,
Laboratorien, Dreh-Equipment und Tonstudios umfasst, die im
gesamten afrikanischen und arabischen Raum als die besten
gelten. Seit den 1990er Jahren wird eine Koproduktionspolitik
mit Filmen aus Mali, der Elfenbeinküste oder Tunesien
verfolgt. So hat etwa die gesamte Postproduktion von "Mooladé"
(2003), Sembene Ousmanes letztem Film, hier stattgefunden.
Wir sind dem CCM zu besonderem Dank
verpflichtet
Brigitta Kuster und Madeleine Bernstorff
|